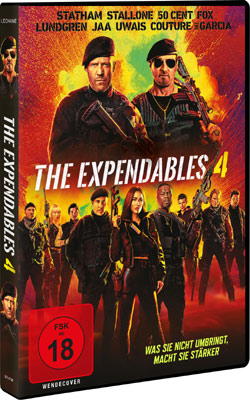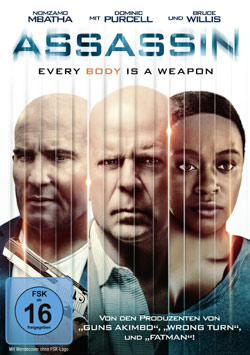| Originaltitel: 60 Minuten__Herstellungsland: Deutschland__Erscheinungsjahr: 2024__Regie: Oliver Kienle__Darsteller: Emilio Sakraya, Dennis Mojen, Marie Mouroum, Florian Schmidtke, Paul Wollin, Aristo Luis, Morik Heydo, Alain Blazevic, Harry Szovik, Árpád Antolik, Ludger Bökelmann, Philipp Droste, Szabolcs Kelemen, Livia Matthes, Balázs Megyeri, Bruno Salgueiro u.a. |


Das Poster von “60 Minuten”.
Leonie hofft. So wie es Töchter eben tun, wenn ihr Vater es mal wieder nicht rechtzeitig zur Geburtstagsfeier schafft. Die Ex-Frau ist verzweifelt, droht mit der Beantragung des alleinigen Sorgerechts, sollte er nicht binnen einer Stunde auf der Matte stehen. Das Ultimatum ist gesetzt, nun ist es also Zeit, die Stoppuhr einzuschalten. Digitale Ziffern leuchten im Bild auf, so wie einst in der Echtzeitserie „24“. Die Hektik ist auch dieselbe, denn Berlin ist groß. Es gilt in der verbliebenen Zeit nicht nur, den Stadtkern von Nordwest nach Südost zu durchqueren, sondern dabei auch unzählige Gegner aus dem Weg zu räumen. Unserem Helden bleibt nur das Vertrauen in seine körperlichen Fähigkeiten. Und Octavio rennt.
Während Lola mit ihrem Spurt durch das Berlin der 90er zumindest noch gegen ein Netz der Kreinkriminalität antrat, um ihren Freund Manni aus deren Klauen zu befreien, ist bei „60 Minuten“ alles andersherum. Octavio zieht sich den Zorn zwielichtiger Gestalten überhaupt erst deswegen zu, weil ihm die Mutter seiner Tochter in der unmöglichsten Situation telefonisch Befehle zu erteilen meint. Zugegeben: Der Mann, der vom System (Job, Geld, höhere Mächte) am Familienglück gehindert wird, er ist ein unverwüstliches Klischee des internationalen Actionkinos, welches zu replizieren nur recht und billig ist. Die Sehnsucht nach dieser Konstellation scheint bei Oliver Kienle (Drehbuch und Regie) aber so groß zu sein, dass er gerade im Aufbau der Handlung allerhand Konstruiertes in Kauf nimmt, um auf Gedeih und Verderb Leonies Geburtstagsparty zum ultimativen Ziel zu erklären.
Dass ihr Vater, ein MMA-Kämpfer, noch auf dem Weg zum Ring von seiner Ex in einer Tour telefonisch gepiesackt wird, als könne eine Aussprache nicht bis zum Abend warten (aber wir leben nun mal im Zeitalter der permanenten Erreichbarkeit, nicht wahr?), lässt bereits den gesamten Rahmen auf wackligen Beinen stehen. Schließlich nutzt das Skript von „60 Minuten“ hier die bewährte Spiel-auf-Zeit-Konstruktion, die traditionell dazu gedacht ist, handfeste Katastrophen zu verhindern, bei denen Menschenleben auf dem Spiel stehen. In „Gegen die Zeit“ (1995) soll eine Gouverneurin getötet werden, damit die Tochter des Helden verschont bleibt, in „88 Minuten“ (2007) wird der Protagonist höchstselbst mit dem Tod bedroht, in „24“ geht es mitunter um die Zukunft von ganz Amerika. Bloß in „60 Minuten“, da sind es einfach die verletzten Gefühle einer Mutter, die den Trigger liefern.

Gestern kam John Wick noch zum Tanzen vorbei, heute legt Octavio eine flotte Sohle hin.
Dass der Vater daraufhin einen wichtigen Titelkampf sausen lässt, um die Beziehung zu seiner Tochter zu kitten, soll ihm natürlich Sympathiepunkte einbringen. Allerdings torpediert die folgende Charakterzeichnung diesen noblen Ansatz im Anschluss permanent. Hauptdarsteller Emilio Sakraya interpretiert seine Figur als impulsiven, kurzsichtigen, zur Aggressivität neigenden Einzelgänger, der dazu neigt, permanent falsche Entscheidungen zu treffen. Das mag notwendig sein, um den Berliner Jungen von der Straße authentisch wirken zu lassen, jedoch fallen die dargestellten Aggressionsschübe bei weitem zu extrem aus, um ihn für das vom Skript bemühte Heldenbild zu empfehlen. Zuerst wird das Armaturenbrett aus dem Auto des eigenen Kumpels vor lauter überschäumendem Adrenalin halb auseinandergenommen, später zwei Polizisten mit einem Schwall von „Halt die Fresse“-Phrasen befeuert, die tourette-artig den Mund des Kämpfers verlassen, der ansonsten eigentlich ein eher schüchterner Kerl ist, der am liebsten mit düsterem Ausdruck ins Nichts starrt. In einem Sozialdrama wäre das keine uninteressante Anlage, in einem Actionfilm der Marke „Ein Mann gegen das Unrecht“ hingegen, der sich ganz bewusst eingefahrener Mechanismen bedient, wäre dann doch ein Funken mehr Coolness angebracht.
Deutschland hat ja doch eine gewisse Tradition im Martial-Arts-Actionfilm mit teils recht skurrilen Beiträgen vorzuweisen („Die Brut des Bösen“, 1979; „Macho Man“, 1985) und ist auch heute noch aktiv im Geschäft („Plan B: Scheiß auf Plan A“, 2016; „African Kung-Fu Nazis“, 2019), insofern ist die Hoffnung vorhanden, dass zumindest an dieser Front die Kohlen aus dem Feuer geholt werden. Sakraya ist nicht nur Schauspieler, sondern hat auch bereits den ein oder anderen Kampfsporttitel errungen. Tatsächlich überzeugt er am meisten, wenn er seine Energie über Hände und Füße loswird anstatt über den geöffneten Mund. Er übernimmt eine physisch überaus fordernde Rolle, die vor allem jede Menge Sprints absolvieren muss. Nach dem Vorbild französischer Traceurs, die sich die Banlieues rund um Paris zu eigen machen, wird Berlin mit seinen Verkehrsinfarkten, seinen verschmutzten Seitengassen, Clubs und U-Bahn-Stationen zum erlebnisreichen Hindernisparcours.
Da wird über Motorhauben geschlittert, durch überfüllte Gassen manövriert und mitsamt Stuhl und Fessel stuntreif in eine abfahrende Bahn gesprungen. Kienle gelingt es immerhin, die deutsche Hauptstadt abwechslungsreich in Szene zu setzen, auch wenn sie sich letztlich keinen Deut von den Hollywood-Interpretationen abhebt. Man hat leider oft das Gefühl, die Berlin-Passage aus „John Wick 4“ noch einmal im Kleinformat zu sehen. Überhaupt wäre etwas weniger Orientierung an internationalen Formaten und etwas mehr Mut zur Entwicklung eigener Standards wünschenswert gewesen. Wenn sich Tatjana Sojic im Businessanzug wie eine abgeklärte Helen Mirren in den Untergrund begibt, um dem Fighter in die Augen zu schauen und ihm face-to-face den größeren Kontext zu erklären, oder wenn ein Kätzchen im Karton durch die Gefahrenzone transportiert wird wie einst die Babys aus „Hard Boiled“ und „Shoot ’em Up“, dann wird schon recht auffällig auf den internationalen Markt geschielt. Guy Ritchies „Snatch“ wird in einer Sequenz sogar fast 1:1 abgekupfert, als in Zeitlupe lautstark lamentiert wird, während die Hauptfigur kurz vor der Explosion steht. Zwecks globaler Netflix-Auswertung ergibt diese Marschrichtung auch durchaus Sinn, nur für die so wichtige langfristige Entwicklung des deutschen Genrefilms ist ein solches Vorgehen eher kontraproduktiv, bleibt doch die Kreativität beim Kopiervorgang auf der Strecke.

Mit bloßem Auge nicht zu sehen, am Gesichtsausdruck jedoch zu erahnen: Hier fliegen die Spuckefäden.
Die eigentlichen Fights werden auf einem durchaus anspruchsvollen Niveau dargeboten. Weniger stilisiert zwar als bei Wick & Co., setzt die Choreografie eher auf die kantige Marke und bleibt in der Ausführung roh und ungeschliffen, was sich mit dem hitzköpfigen Charakter der Hauptfigur, der blindlings von einer Lage in die nächste stolpert, gut verträgt. Seine Gegner bilden sich vornehmlich aus einer Schar gesichtsloser Henchmen, von denen einige zumindest ein paar nette Moves zu bieten haben, die man ihnen nicht immer von der Nase ablesen kann. Aristo Luis, der Octavios großkotzigen MMA-Gegner spielt, eine Art Clubber Lang („Rocky III“) mit sauertöpfischer Miene, wird vergleichsweise schnell und unspektakulär verheizt, als er sich später bei der Verfolgungsjagd einmischt. An der Seite des Helden kann sich lediglich Hollywood-Stuntfrau Marie Mouroum noch hervorheben, hat sie doch einige der besten Kampfeinlagen zu verbuchen.
Regietechnisch wird ein wenig mit Splitscreens experimentiert, die sich ergeben, wenn Octavio seinen Floh im Ohr aktiviert und am anderen Ende der Leitung der Gesprächspartner an den Hörer geht. Die Einbindung moderner Kommunikationsmittel setzt einen netten Kontrast zur eher oldschooligen Anlage des Plots, dessen Eckpfeiler aus den 80er oder 90er Jahren stammen könnten. Wirklich innovativ sind aber auch diese Stilmittel nicht, nicht einmal, wenn wir exklusiv vom deutschen Film reden.

Das Handicap, zwei Gegnern gegenüberzustehen, gleicht der nette Herr Fiesling gekonnt mit einem Brecheisen aus.
„60 Minuten“ fühlt sich ein bisschen an wie ein Placebo für ausgewachsene, international konkurrenzfähige Echtzeit-Spielfilmformate mit feingeschliffenen Drehbüchern und stilvoller Umsetzung. Vom Handlungsauslöser über die Figurenzeichnung bis hin zu den Fights wirkt alles eine Nummer harmloser und weniger ernstzunehmend als bei der Konkurrenz. Die Hauptfigur irritiert zudem mit seltsamen Wutausbrüchen, die manchmal fast schon ins Psychopathische zu kippen drohen. Emilio Sakraya beweist unter seiner blondierten Mähne trotzdem etwas Ausstrahlung und punktet vor allem mit seiner Physis; zumindest Ersteres kann man von seinen Gegnern eher nicht behaupten. Es ist dennoch schön, dass sich deutsche Filme weiter beharrlich an Genres versuchen, die weder dem Geschichtsfilm noch der Komödie noch dem intellektuellen Drama angehören. Dies gilt es bei allen Fehlschlägen auszubauen.
![]()
„60 Minuten“ ist seit dem 19. Januar 2024 exklusiv über Netflix abrufbar.
Sascha Ganser (Vince)
Was hältst du von dem Film?
Zur Filmdiskussion bei Liquid-Love
| Copyright aller Filmbilder/Label: Netflix__FSK Freigabe: ungeprüft__Geschnitten: Nein (Deutschland)__Blu Ray/DVD: Nein/Nein |